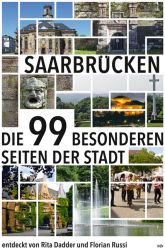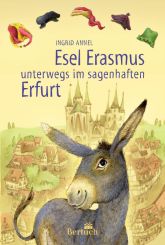Was sagt man nicht alles über uns Saarländer, in der Pfalz, im Trierischen, im Reich, wie man früher bei uns sagte, wenn man Deutschland jenseits des Rheins meinte? „Saarfranzose" war zu meiner Kinderzeit ein Schimpfwort, jedenfalls fassten wir es so auf, und es war wohl auch so gemeint. Aber wir sind und waren keine Franzosen, wollten keine werden. Mein Vater hätte keine Baskenmütze aufgesetzt. Während der französischen Besatzung erklang am 14. Juli bei den Aufmärschen in Saarbrücken und Saarlouis die Marseillaise. „Aux armes, citoyens!", heißt es an einer Stelle. Insgeheim sang man im Saarland auf die entsprechende Melodie: „O jeh, ma sinn franzeesch!" Vor einigen Jahren las ich die aus dem Nachlass herausgegebenen Aufzeichnungen des Differter Jesuiten Peter Lorson, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte. Sein Lebensweg zwischen Deutschland und Frankreich führte mehr durch gefährliche Kurven als über gerade Strecken. Den will ich hier nicht nachzeichnen, aber eine Bemerkung in dem Buch irritierte mich. Gegen Kriegsende - Frankreich war schon von der deutschen Besatzung befreit - schrieb er an den französischen Außenminister Georges Bidault, sein Land solle das Saargebiet annektieren, die Saarländer seien Franzosen, sie wüssten es nur nicht. Wir wollen es dem Jesuiten mit dem französischen Namen aus dem Grenzdorf nicht übel nehmen. Wer weiß, aus welcher Situation heraus er das geschrieben hat damals, aber er irrte sich. Franzosen sind wir nicht, aber ein buntes Gemisch, wenn man es von den Vorfahren her betrachtet. Meine stammen aus Lothringen, Luxemburg und der Wallonie (heute Belgien), von der unteren Saar und vom Hunsrück, aus Ostpreußen und natürlich aus dem Bereich des heutigen Saarlandes; die meiner Frau in der Hauptsache aus der Ecke zwischen Saarbrücken und Saarlouis, aber auch aus Lothringen, dem Elsass und aus Tirol.
Das Vorurteil, an der Saar spreche man Französisch, gibt es noch immer. Ich will mich nicht lange mit der Metzgerin in Esslingen am Neckar aufhalten, die mein Deutsch lobte, als ich 1951 während einer Radtour dort vorbeikam. Seitdem ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, und die Tochter oder Enkelin der Metzgerin, die vielleicht heute dort Koteletts verkauft, wird es besser wissen, hätte ich gedacht, wenn es nicht vor wenigen Wochen einen Anlass gegeben hätte, daran zu zweifeln. Bei einer Feierlichkeit in Saarlouis sprach ich mit dem Neffen eines Freundes, den es vom Main an die Saar verschlagen hatte. Er hatte geglaubt, an der Saar spreche man Französisch. Das ist keine zwanzig Jahre her.
Seit Jahren läuft auf verschiedenen Kanälen die Serie mit der Familie Becker. Manche, die sie drüben in Deutschland sehen, glauben, im Saarland spreche man wie Heinz, Hildegard und Stefan Becker. Auf diese Ansicht traf ich vor zwei Jahren, als ich mich mit dem Enkel meiner Kusine in Püttlingen unterhielt. Er ist in Rastatt aufgewachsen und kann nicht wissen, dass dies in etwa der Dialekt im Industriegebiet zwischen Saarbrücken und Neunkirchen ist und dass man im Saarpfalzkreis und zum Hochwald hin, vor allem aber um Saarlouis und im Kreis Merzig-Wadern anders spricht, um so mehr, je näher man zur Mosel kommt. Ich ließ ihn eine Kostprobe hören, die ihn sehr belustigte: Eine alte Saarlouiserin wird von einer neu zugezogenen Nachbarin eingeladen. Nach einem Plauderstündchen bei Kaffee und Kuchen verabschiedet sie sich mit den Worten: „Allee dann, deckmols merci ach for Auer Gudhäd un hallen Auch kurasch!"
Es führt zu nichts, den Saarländer nach seiner Sprache zu definieren. Ich wende mich wieder dem Thema zu: Wenn zwei Saarländer sich treffen ...
Wer sich von Oskar Lafontaine leiten lässt, wird glauben, die Fortsetzung laute: „ ... dann essen sie erst mal zusammen etwas Gutes", ganz nach dem Prinzip, das man ihnen unterjubelt: „Hauptsach gud gess, geschafft ham mir dann schnell." Ich protestiere. Das ist eine Unterstellung nach der gängigen Freizeit- und Vergnügungsmentalität. Geschafft ham mir imma un vill, awa nit imma gud gess, läda Goddes.
Richtig heißt es: Wenn zwei Saarländer sich treffen, kennen sie sich, oder sie haben wenigstens gemeinsame Bekannte. Dazu vier Geschichten.
Vier Personen waren zu einer Besichtigung der Römischen Villa in Borg angemeldet, ich sollte sie begleiten. Es kamen zwei Frauen meines Alters, ein etwas älterer Mann und eine junge Frau. Einer der älteren hörte man die Herkunft aus der Umgebung von Saarlouis an, den beiden anderen nicht. Der Mann hielt sich zurück, er sagte nichts. Nach einigen Minuten fing die Frau ohne Dialekteinschlag an, dem Mann meine Erklärungen ins Englische zu übersetzen. „You are English?" fragte ich. „Mein Mann ist Amerikaner", gab die Frau zurück. Die Besichtigung ging weiter, der Amerikaner war nicht brennend interessiert. Bis Amerika waren die Römer schließlich nicht gekommen. „Sie leben in Amerika?" fragte ich. Manchmal ergibt sich ein Anknüpfungspunkt, wenn man etwas über die Herkunft der Besucher weiß. Die Frau gab gern Auskunft: „Ja, in Amerika. Jetzt sind wir zu Besuch bei meiner Schwester in Differten und nutzen den Urlaub, um meinem Mann ein wenig meine Heimat zu zeigen. Deshalb brachte unsere Nichte uns hierher. Mein Mann war im Krieg als Soldat hier." - „Sie sind aus Differten", entgegnete ich, „dann ist Ihr Heimatort nicht weit von meinem entfernt. Hier sind wir zugezogen. Ich stamme aus Wehrden und meine Frau aus Schaffhausen." Sie erinnerte sich: „Ja, das sind wirklich nur ein paar Kilometer von Differten über Werbeln nach Schaffhausen und Wehrden." Im Weitergehen sagte ich: „Ich überlege gerade, ob ich jemand aus Differten kenne. Im Augenblick fällt mir nur ein Schulkamerad ein, mit dem ich in den Jahren 1946/47 in Saarlouis in derselben Klasse war. Er heißt Rudi D." - „Das ist mein Bruder!" rief sie und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Der Amerikaner war bei dem lebhaften Gespräch, das von entsprechender Mimik und Gestik begleitet war, aufmerksam geworden. Wahrscheinlich dachte er, ich hätte die Rückkehr der Römer angekündigt. „What happend?" fragte er. „He knows Rudi", sagte seine Frau. „He knows Rudi?" wiederholte er halb ungläubig, als hätte er eine Invasion der Römer eher für möglich gehalten.
Der Ort der Handlung ist derselbe, die Römische Villa. Eine achtköpfige Gruppe war angemeldet worden. Die Telefonnummer verriet, dass der Anruf aus der Moselgegend gekommen war. Also echte Nachkommen der Römer, dachte ich, die werden nicht unbeleckt sein, das kann ein unterhaltsamer Vormittag werden. Und so kam es auch. Die Besucher dieses Tages waren sehr interessiert und wohl informiert. Sie fragten nach, ergänzten meine Darlegungen aus eigenem Wissen und Erleben, waren gut aufgelegt und gewiss mit dem Tag zufrieden. Öfter kommt es vor, dass Besucher gegen Ende der Besichtigung wissen wollen, mit wem sie es da zu tun haben. Manche fragen ohne Umschweife: „Haben Sie hier bei der Ausgrabung gearbeitet?" andere: „Waren Sie Lehrer?" So gerade heraus machten's diese nicht. „Wo haben Sie studiert? Sind Sie vom Fach?" fragten sie. Knappe Antwort: „Ich dachte, sie hätten's erraten, ich war Lehrer." - „Für welche Fächer?" - „Ich war Volksschullehrer, also für alle Schulfächer, wie das damals üblich war, danach Realschullehrer für Deutsch und Französisch, nicht für Geschichte und Latein." Damit war auch schon die Frage beantwortet, die als nächste gestellt worden wäre. Alle lachten. Das Gespräch wandte sich einem anderen Thema zu: römische Funde beim Ausheben einer Baugrube. Das ist nicht selten in der Trierer Gegend. „Bei meinem Elternhaus kamen römische Münzen und Gefäße ans Licht. Da war ein Kastell." - „Dann sind Sie aus Pachten?" warf ich ein. Nun war ihr Interesse an meinem schulischen Hintergrund wieder geweckt, wobei ich den Zusammenhang zunächst nicht durchschaute. Sie fragte: „Wo waren Sie in der Schule, in Saarbrücken?" - „Ja, in St. Arnual war meine erste Stelle, dann ging es saarabwärts nach Rockershausen, nach Wehrden und schließlich nach Dillingen." - „An welcher Schule waren Sie in Dillingen?" - „In der Realschule." - „Da war ich auch." - Also waren Sie Lehrerin? Dann müssen Sie vor mir dort gewesen sein." - „1967 bin ich weggegangen." - „Wir haben uns um zwei Jahre verpasst, ich bin 1969 nach Dillingen versetzt worden." - „Dann kennen Sie doch meine Freundin A. und die Kollegen ..." Es folgte die Aufzählung der gemeinsamen Bekannten, während der eine oder andere schon der Taverne zustrebte.
Sie handelt von der Begegnung mit dem ehemaligen Handballspieler aus Niederwürzbach, der anlässlich eines Familienfestes mit seinen Angehörigen den Ausflug nach Borg unternahm. Wahrscheinlich dachte er, einer aus der Perler Gegend habe noch nie etwas von seinem Wohnort gehört, weswegen er sagte, sein Dorf sei in den fünfziger und sechziger Jahren eine Hochburg des Handballsports gewesen. „Ja, wie Lisdorf, Wadgassen und Wehrden", bestätigte ich. Er strahlte übers ganze Gesicht, als er erfuhr, dass ich einige von den Spielern gekannt hatte, an die er sich erinnerte.
Die Sache funktioniert auch, wenn sie sich nicht auf heimischem Boden abspielt, wer weiß, vielleicht erst recht? Dazu die folgende Begebenheit, die sich vor acht oder zehn Jahren zutrug.
Wir waren für eine Woche bei unserer Tochter in Wien. Wie jeder weiß, gibt es in der Stadt viel zu besichtigen und zu bewundern. Mich zog es - die mich kennen, wissen warum - in das berühmte Pfand- und Versteigerungshaus in der Dorotheergasse. Im Erdgeschoss standen die Gegenstände, die man gleich erwerben konnte. Vor einem Satz Thonet-Stühlen blieb ich stehen, prüfte das Holz, das Geflecht, den Preis und murmelte vor mich hin: „In Metz waren die billiger." Da sagte jemand hinter mir: „Sie fahren von hier nach Metz, um Möbel zu kaufen?" Ich wachte aus meinem Flohmarkttraum auf, wandte mich um und sah ein Ehepaar, einige Jahre jünger als ich, mit einer erwachsenen Tochter. „Nein, nicht von hier, von zu Hause, das ist nicht so weit." Die Annäherung folgte Schritt für Schritt:
Wohnen Sie im Saarland?
Ja.
Wo denn da?
In der nordwestlichen Ecke, im Kreis Merzig.
Ich bin aus der Saarbrücker Gegend.
Ach, Sie sind Saarländerin?
Ja, aber mein Mann ist Wiener, ich wohne schon zwanzig Jahre hier.
Ich stamme auch aus dem Kreis Saarbrücken, aus Völklingen.
Sie sagten doch eben Merzig?
Ja, dahin sind wir vor 12 Jahren gezogen, in die Gemeinde Perl.
Kennen Sie Altenkessel, da komme ich her?
Rockershausen gehört zu Altenkessel.
Ja, wieso kommen Sie jetzt auf Rockershausen?
Da war ich in den fünfziger Jahren Lehrer.
War das noch die alte Schule an der Bahn?
Ja. Kannten Sie die?
Und wie, dahin ging meine ... ! Aber dann kennen Sie doch ... .
Die Liste der hier aufzuzählenden Personen erspare ich mir. Ehemann und Tochter waren für eine Weile abgemeldet, verständnisvoll lächelnd wandten sie sich anderen Ausstellungsstücken zu. Die Altenkesselerin hatte einen Saarländer getroffen, in Wien, im Dorotheum.
*****
Vorschaubild: Rita Dadder