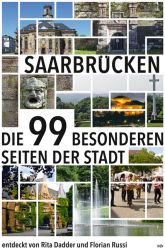30. Juni 2012
Alle waren „vor Ort"
Auch von dieser Kirche „Heiligstes Herz Jesu" in Hostenbach, Gemeinde Wadgassen, erklang das Geläute und erinnerte daran, dass an der Saar eine Epoche zu Ende geht. Hier ließen die Wadgasser Prämonstratenser seit Beginn des 17. Jahrhunderts nach Kohlen schürfen. In den nachfolgenden Jahrhunderten ist Hostenbach als Bergmannsdorf groß geworden. Die kegelförmigen Hügel, die man auf dem Bild hinter der Kirche sieht, sind nicht die Schlackenhalden der ehemaligen Grube, die 1932 von der damals französischen Verwaltung der Saargruben stillgelegt wurde, sondern die Abraumhalden der Völklinger Hütte. Die „Grubenkipp" erhob sich rechts daneben und ist auf dem Foto nicht zu sehen. So nah lagen Steinkohlenbergbau und Eisenindustrie hier zusammen.
Ohne den Bergbau, zunächst auf Metallerze, vor allem Eisen, dann auf Steinkohle, schließlich die Eisenindustrie wäre die Geschichte dieses Landstrichs im Südwesten Deutschlands anders verlaufen, hätte es die Bevölkerungskonzentration an der Saar nicht gegeben. Sie kam durch Zuzug aus den Nachbargebieten und aus ferneren Landesteilen zu Stande. Die Hälfte meiner Klassenkameraden Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre hatte Großeltern in Dörfern außerhalb des Industriegebietes, im Hochwald, in der Pfalz.
Meine Familie kann nicht als exemplarisch gelten, was den Bergbau betrifft, und doch wurde ein Zweig meiner Vorfahren im 17. Jahrhundert durch die am Hochwald in der Umgebung von Hermeskeil entstehende Eisenverhüttung aus der Wallonie ins Land gelockt, schließlich von dort in die Neunkircher Gegend und nach Geislautern, immer dorthin, wo es Eisenindustrie gab. Andere kamen in späterer Zeit aus dem Luxemburgischen und sogar aus Ostpreußen und fanden in der Industrie an der Saar Arbeit und Brot. Im Steinkohlenbergbau war keiner meiner Vorfahren in direkter Linie beschäftigt, wohl aber andere Verwandte.
Was bleibt nun vom jahrhundertelangen Bergbau an der Saar? In Ensdorf scheint - soweit man es aus den Berichten entnehmen kann - keiner davon gesprochen zu haben, dass die Energieerzeugung eines Tages so teuer werden könnte, dass sich die Kohlenförderung an der Saar wieder lohnen könnte, ja sogar nötig würde. Manche im Land sagen das. Wunschdenken? Schwarzseherei? Als Schulkinder haben wir vor vielen Jahrzehnten gelernt, die Kohle werde auch das Schwarze Gold genannt. Bis 1700 Meter war man zuletzt in die Erde gedrungen, um sie abzubauen. Über der Erde bleiben die Halden, die Fördertürme, die anderen Gebäude. Bekommen wir ein weiteres Weltkulturerbe wie die Hochöfen und die Gasgebläsehalle von der Völklinger Hütte?
Auch aus der Sprache der Bergleute wie aus anderen vergangenen Berufszweigen wird einiges bleiben. Schon heute heißt es allenthalben in der Berichterstattung, wenn von einem Unglück die Rede ist, die Helfer - Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr - seien schnell „vor Ort" gewesen. Die sich so ausdrücken, wissen sie noch, dass „vor Ort" nicht „an einer beliebigen Stelle" heißt, sondern ein Ausdruck aus der Bergmannssprache ist und die Stelle meint, wo der Bergmann unter Tage arbeitet und die Kohle abbaut? Die Wendung ist in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, aber es wird sich schon immer mal wieder jemand finden, der daran erinnert, woher sie ursprünglich kommt. Anderes wird ganz vergessen werden. Wie lange wird man in den Warndtdörfern noch wissen, dass die Frau dem Bergmann ein „Briggee", ein Schichtenbrot mit auf die Arbeit gab und er bei Gelegenheit ein „Muddagletzje", ein Mutterklötzchen von der Grube mitbrachte, also ein Stück Abfallholz, das er zu Hause spaltete, um Anfeuerholz für den Küchenherd zu machen?
*****
- Foto "Kirche Heiligstes Herz Jesu in Hostenbach": Hans Herkes
- Foto "Bergbaudenkmal": Denkmal Schacht Haverlahwiese, Urheber: AxelHH, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons